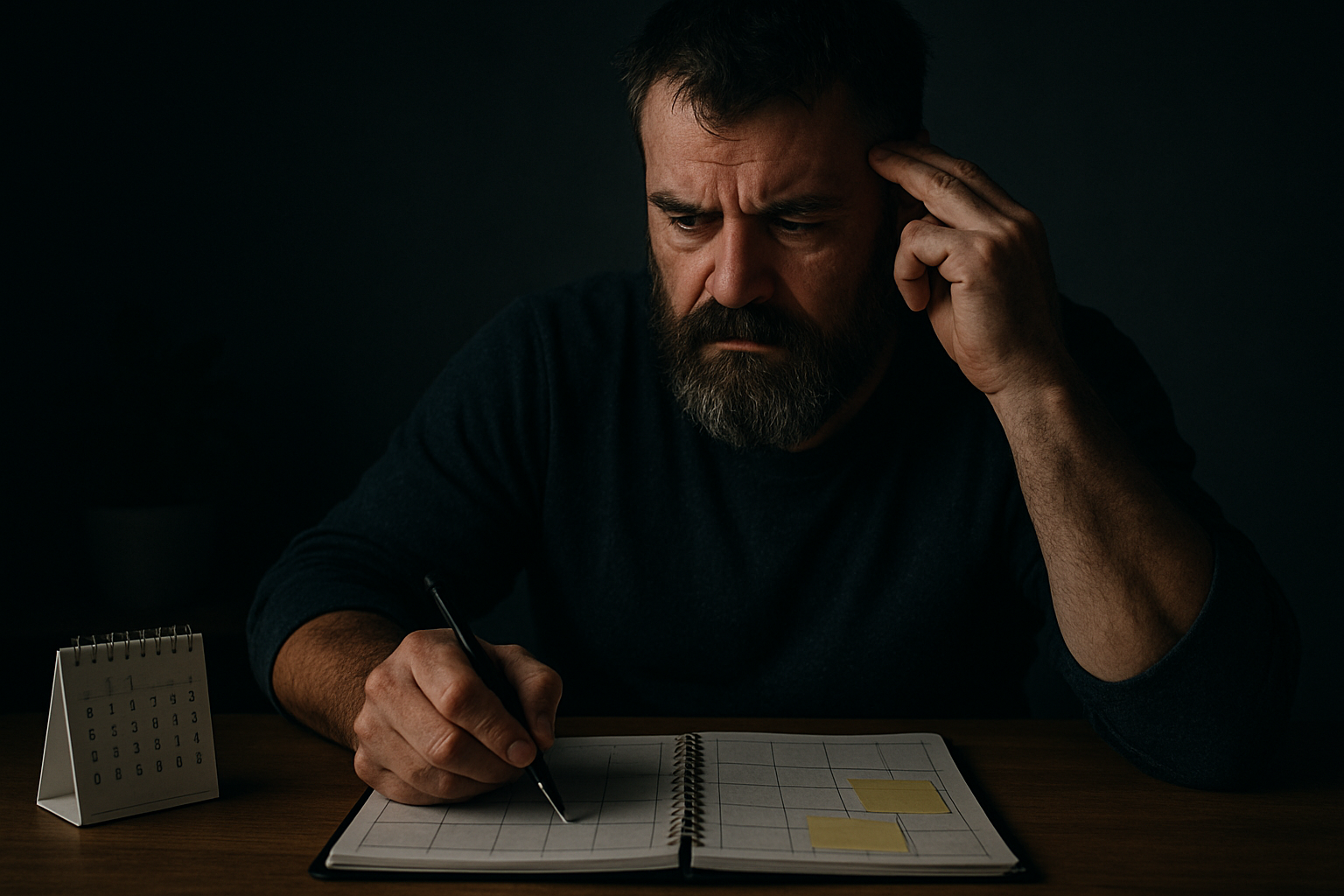Pacing ist für mich und so gut wie alle anderen ME-Betroffenen die wichtigste Säule in Sachen Therapie. Pacing heilt die Erkrankung nicht – zum jetzigen Zeitpunkt existiert keine Heilmethode. Es unterstützt aber dabei, die Symptome im Griff zu behalten und eine weitere Verschlechterung zu verhindern oder zumindest zu begrenzen.
Was bedeutet „Pacing“?
Pacing bedeutet – ganz allgemein formuliert -, mit der eigenen Energie hauszuhalten. Bei ME/CFS ist die Kraft sehr begrenzt, deshalb hilft es, Aktivitäten bewusst einzuteilen, rechtzeitig Pausen zu machen und die Signale des Körpers ernst zu nehmen. Wer Pacing anwendet, versucht, nicht mehr Energie zu verbrauchen, als tatsächlich vorhanden ist. So lassen sich Rückschläge („Crashs“) vermeiden, und der Alltag kann etwas besser gemeistert werden.
Konzepte zum Pacing sind dabei sehr individuell und die Bandbreite der Konzepte ist riesig. Jeder Betroffene ist hier gefragt, sich eine Methode zu entwickeln die für ihn im Alltag praktikabel und vor allem auch kontinuierlich durchzuhalten ist. Ganz grundsätzlich erfordert Pacing ein hohes Maß an Selbstbeobachtung und Disziplin. Und es erfordert eine ständige Anpassung, denn leider ist der Verlauf von ME alles andere als zuverlässig.
Wie ich es umsetze
Das hier ist keine Anleitung zum Pacing, aber vielleicht findet der ein oder andere hier Aspekte, die er für sich selbst verwenden kann. Es hat recht lange gedauert, bis ich meinen „Modus“ gefunden habe, aber mittlerweile funktioniert das ganz gut.
Beobachten
Bevor es ans Umsetzen geht, braucht es eine solide Beobachtung: Was mache ich eigentlich konkret den ganzen Tag? Welche meiner Aktivitäten fressen Energie, welche füllen die Ressourcen wieder auf? Gibt es Aktivitäten, die sich neutral verhalten?
Ich habe zu Beginn meiner Pacing-Strategie ein Aktivitätstagebuch geführt. Das fing im ersten Schritt an mit einer ganz groben Aufzählung all der Dinge, die man so von Aufstehen bis Schlafengehen so macht. Schnell zeigte sich, dass es nicht ausreicht, sich das „für die Arbeit fertig machen“ anzusehen: das war nicht detailliert genug, um einzelne Energiefresser zu entlarven. Und so wurde daraus „Kleidung zurechtlegen, Zähne putzen, duschen, abtrocknen, Haare föhnen, Haare stylen, Anziehen, Schuhe anziehen“. Denn jeder dieser Teilaspekte verbraucht unterschiedlich viel Energie und das auch noch abhängig von der Tagesform. Und genau das wird für eine spätere Anwendung entscheidend werden.
Am Ende der Beobachtungsphase entstand eine erschreckend detaillierte Liste von Alltags-Aufgaben. Und die gilt es nun einzuordnen.
Energiebedarf oder -gewinn zuordnen
Um später ordentlich planen zu können wird nun jeder Punkt dieser Liste darauf untersucht, wieviel Energie er verbraucht oder gewinnt. Dafür braucht es zu allererst eine praktikable Maßeinheit, und für mich war es am einfachsten, dafür die Regenerationszeit zu verwenden: Als Maßstab für Energieverbrauch oder -Gewinn nehme ich den Energiegewinn aus 10 Minuten Ruhen im Liegen und ohne äußere Reize (sprich: Vorhänge zu, Beine hoch, kein Fernsehen, Smartphone oder Lesen). Das entspricht dann einen Punkt auf meinem Energiekonto, und am Ende vereinfacht das die Einordnung des Energiestromes ganz erheblich. Nun kann ich sagen: Haare föhnen verbraucht 2 Punkte, denn um den Verbrauch wieder aufzufüllen muss ich 20 Minuten ruhen.
Anhand eines „durchschnittlichen“ Tages habe ich dann jeder Aktivität eine Punktzahl zugeordnet. Positive Werte für Energiegewinn und negative Werte für den Verbrauch.
Baseline
Ich dokumentiere meinen Energiehaushalt jeden Tag in einer Excel-Tabelle. An einer App, die das Ganze deutlich vereinfacht, arbeite ich schon seit geraumer Zeit, weil die aber nunmal auch Energie frisst komme ich nur langsam weiter. Am Ende eines jeden Tages werden positive und negative Werte aufsummiert und ich berechne daraus meine „Baseline“. Die hat den Wert 1, wenn das Konto am Tagesende auf Null steht (also ausgeglichen ist). Gibt es einen Energieüberschuss, ist das Ergebnis größer als 1, habe ich ein Defizit erwirtschaftet ist es kleiner. Damit bekomme ich nicht nur eine gute Verlaufskontrolle, sondern auch ein für mich etabliertes Instrument, den kommenden Tag zu planen.
Hinter dem ganzen steckt zugegeben ein ziemliches Excel-Formel-Monstrum, aber die Arbeit macht man sich ja nur einmal und verplempert in der Folge nicht noch jeden Tag Energie für’s Rumrechnen.
Praxiseinsatz
Es geht an die Umsetzung, und die klingt für Außenstehende vielleicht etwas grotesk. Am morgen eines jeden Tages nehme ich mir meine Aktivitäten-Liste vor und überlege, was davon heute Priorität hat und was vielleicht noch zusätzlich auf die Agenda muss. Meine „Standardwerte“ aus der Beobachtungsphase teile ich durch die Baseline des Vortages. War der nun schlecht (mit einer negativen Bilanz), so wird der Verbrauch für energiezehrende Aktivitäten automatisch höher kalkuliert. Um dies wieder auszugleichen spiele ich im Anschluss mit den Erholungsphasen und plane diese so, dass am Ende wieder mindestens eine Null-Bilanz herauskommt. Gab es am Vortag einen Energie-Überschuss, so kann ich mir auf diesem Weg Raum für zusätzliche Aktivitäten verschaffen.
Mein erklärtes Ziel ist es eigentlich immer, einen Tag so zu planen dass ein Überschuss entsteht. Das ist meine Sicherheitsreserve für schöne, aber auch für unerwartete Dinge im Tagesverlauf.
Am Ende des Tages werden die geplanten Werte wieder mit den tatsächlichen ersetzt, um das Ergebnis zu dokumentieren und den kommenden Tag planen zu können. In der Anfangsphase weichen Plan und Ergebnis oft drastisch voneinander ab. Das war – in meinem Fall – ein klares Zeichen für zu optimistische Planung und oft auch mangelnde Disziplin. Mit der Zeit ändert sich das aber, und mittlerweile bin ich ganz gut darin, Punktlandungen zu produzieren. Immer vorausgesetzt, dass nichts großes, unerwartetes passiert.
Sehr schnell wird hier klar, wie wichtig Pausen sind. Und dass sie fest eingeplant sein müssen, damit das Ganze am Ende gut ausgeht. Erholungsphasen sind (leider) das Einzige, auf das man als Betroffener wirklich Einfluss hat, und sie müssen sehr diszipliniert in den Tag eingebaut werden. Je nach Ausgangslage kann es aber auch erforderlich werden, dass einzelne Aktivitäten von der Liste für den Tag gestrichen werden müssen, um Anderes, Notwendiges unterzubringen.
Nutzen und Risiken
Diese Methode (und auch alle anderen Pacing-Konzepte) bringen uns ME-Betroffene raus aus der Machtlosigkeit und geben uns ein Stück Kontrolle über unser Leben zurück. Mit einem funktionierenden Pacing ist es wieder möglich, im Großen und Ganzen schadfrei durch den Alltag zu kommen und eben auch Raum für Aktivitäten zu schaffen, die uns gut tun. Gleichzeitig ist so auch eine recht zuverlässige Verlaufskontrolle möglich – mangels verfügbarer Biomarker ist deren Wert gar nicht hoch genug anzusiedeln.
Das Aufspüren von Triggern ist eine der großen Herausforderungen bei ME, und hier ist konsequentes Pacing eine riesige Hilfe. Quasi als Nebenprodukt der täglichen Planung und Nachschau können sie entdeckt und im Besten fall ausgemerzt werden.
Pacing erfordert aber auch oft akribische Planung und ein hohes Maß an Selbstdisziplin, und das hat – besonders in schlechten Krankheitsphasen – ein recht hohes Frustpotential. Es macht nämlich leider auch sehr sichtbar, wie stark die persönlichen Einschränkungen sind. Und manchmal müssen wir Betroffenen dann eben auf alles Schöne verzichten, nur um nicht komplett abzustürzen. Wer hier sensibel reagiert, der sollte sich in Sachen Pacing wirklich psychologischen Beistand gönnen, denn es ist sehr schnell passiert, dass der Fokus nur noch auf den negativen Aspekten landet.
Außenstehende haben leider oft wenig Verständnis für unseren pacing-bedingten Mangel an Spontanität. Und oftmals bekommt man auf die Erklärung der Ursachen hin ein verständnisloses Kopfschütteln. Es ist eben auch nicht besonders nah dran an einem typischen Lebensmodell, wenn man jeden winzig kleinen Schritt plant. Insofern ist das Unverständnis nachvollziehbar und man sollte einfach darauf vorbereitet sein.
Andere Konzepte
Wie bereits gesagt: jeder Betroffene muss am Ende sein eigenes Konzept finden. Pacing macht nur Sinn, wenn es zu den eigenen Bedürfnissen passt und zumindest soviel „Spaß“ macht, dass es auch konsequent umgesetzt wird.
Es gibt eine ganze Reihe teils völlig anderer Ansätze, z. B. Pacing über Herz-Kreislauf-Parameter via Smartwatch. Das habe ich ausprobiert, nur tut mein Körper mir nicht den Gefallen, sich auch rechtzeitig bemerkbar zu machen. Auch eine ganze Reihe von Apps ist mittlerweile im Umlauf. Mir persönlich fehlt aber bei den meisten die nötige Flexibilität, und auch das Thema Datenschutz ist oftmals etwas fraglich. Vom Grundsatz her gefiel mir bisher „Fimo Health“ am Besten, die gibt es in der Vollversion aber leider nur auf Genehmigung der Krankenkasse mit Rezept, und meine Krankenkasse nimmt leider (noch) nicht teil.