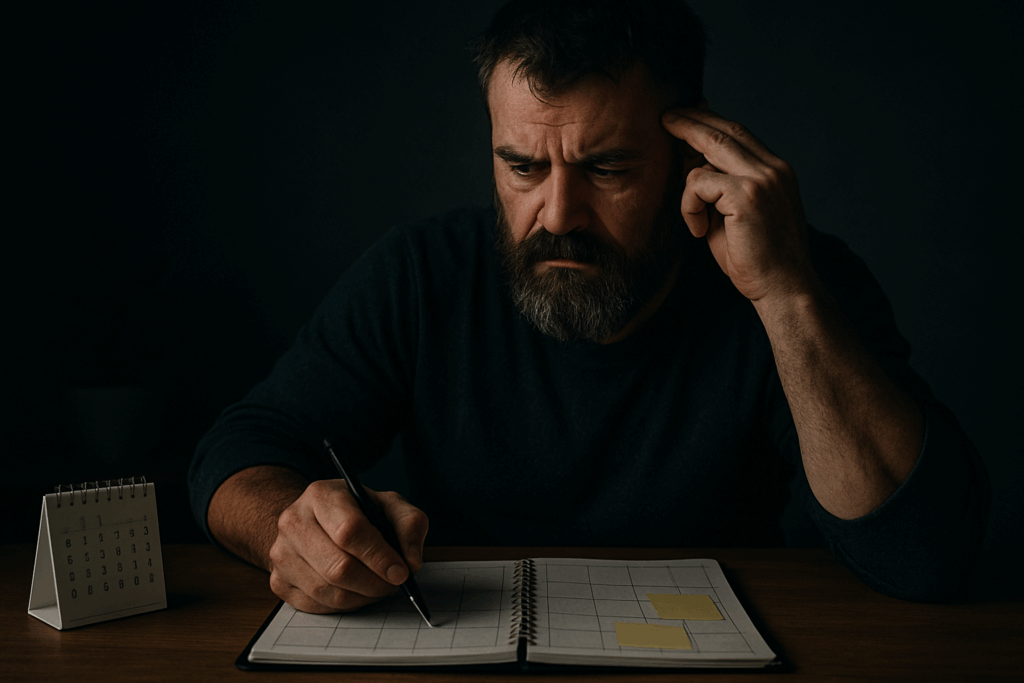Das Symptom, das meinen Alltag am stärksten prägt, heißt PEM – Post-Exertional Malaise, auf Deutsch oft „belastungsbedingte Verschlechterung“. Dahinter steckt keine normale Müdigkeit nach Anstrengung, sondern eine krankheitsbedingte Überreaktion: Selbst kleine körperliche, geistige oder emotionale Reize können zeitversetzt einen „Crash“ auslösen, der Tage (manchmal länger) anhält.
Ich schreibe das hier bewusst persönlich, weil sich PEM von außen oft schwer einordnen lässt. Für mich ist es der Grund, warum ich meinen Tag anders plane, warum ich manches absage – und warum es mir an einem Tag scheinbar „gut“ geht und am nächsten plötzlich gar nichts mehr geht.
Was PEM für mich bedeutet
PEM bedeutet für mich: Dinge, die früher selbstverständlich waren, haben heute einen Preis – und diesen Preis zahle ich nicht sofort, sondern mit Verspätung. Es reicht manchmal eine halbe Stunde konzentriertes Lesen, ein kurzes Telefonat, helles Licht, Lärm, ein paar Treppenstufen oder langes Stehen. Stunden später (oder am nächsten Tag) kommt dann der Crash: schwere Beine, grippiges Krankheitsgefühl, Schmerzen, Denk- und Konzentrationsstörungen, Kreislaufprobleme, Schlaf, der nicht erholt.
Das Gemeine ist die Verzögerung
PEM trifft mich oft erst 12–48 Stunden nach der eigentlichen Belastung. Ein Beispiel, wie sich das anfühlt:
Montag Vormittag: Ich dusche, beantworte 20 Minuten E-Mails und telefoniere kurz. Es wirkt machbar.
Dienstag früh: Die Beine sind bleiern, der Hals kratzt, der Kopf ist neblig.
Dienstag Abend: Grippegefühl, Schmerz, Konzentration kaum möglich.
Mittwoch/Donnerstag: Der Crash hält an; der Körper braucht konsequente Ruhe, nicht „ein bisschen mehr probieren“.
Diese Verzögerung macht Planung schwierig – nicht, weil ich unzuverlässig bin, sondern weil PEM zeitversetzt zuschlägt.
Warum Kleinigkeiten zusammen groß werden
PEM entsteht bei mir oft durch Akkumulation: Mehrere kleine Reize addieren sich. Ein bisschen zu lang sitzen und reden, später helle Lichter im Supermarkt oder bei der Arbeit, dazu Anspannung – einzeln „harmlos“, zusammen genug, um die Schwelle zu überschreiten. Für Außenstehende sieht das nach „nichts Besonderem“ aus; für meinen Körper ist es eine Überfrachtung.
Wie groß PEM werden kann – und welche Risiken damit verbunden sind
- Verlängerte Erholung: Jeder Crash kann die Erholungszeit vervielfachen. Aus „einen Tag ruhig“ wird schnell „eine Woche Ausfall“.
- Rückfälle: Wenn ich zu oft über meine Grenze gehe, rutsche ich in längere Verschlechterungen ab. Dinge, die gerade noch gingen (z. B. Duschen ohne Folgen), sind dann vorerst nicht mehr machbar.
- Sicherheitsrisiken: Im Crash nehme ich Schwindel, Benommenheit und Kreislaufprobleme stärker wahr. Treppen, Duschen, Kochen oder Verkehr brauchen dann besondere Vorsicht.
- Unberechenbarkeit: Weil der Crash verspätet kommt, kann ein „guter Tag“ trügerisch sein. Wenn ich ihn „nutze“, ohne Puffer zu lassen, bezahle ich später – und meist höher, als es der Moment vermuten lässt.
- Soziale und berufliche Folgen: PEM macht mich nicht unzuverlässig aus Willen, sondern aus Symptomlogik. Planbarkeit wird zur Ausnahme; Absagen sind Schutz, kein Desinteresse.
Das mit Abstand größte Risiko von PEM: sie ist der Motor hinter ME/CFS. Jeder Crash kann zu einer dauerhaften Verschlechterung des Zustandes führen, bis hin zu totaler Bettlägerigkeit. Für immer.
Woran ich merke, dass es kippt
Ich habe Vorboten, auf die ich achte: Druck hinter den Augen, Halskratzen, plötzliches „grippig“-Gefühl, Wortfindungsstörungen, Benommenheit, feines Zittern, Schmerzspitzen, unerklärliches Frieren, Herzklopfen im Sitzen/Stehen, Reizüberflutung (Licht/Lärm). Wenn das auftaucht, weiß ich: Stopp – jetzt gegensteuern.
Wie ich vorbeuge und meinen Alltag plane (aus der Ich-Perspektive)
- Ich budgetiere Energie, nicht Zeit: Ein Tag hat für mich nicht „8 aktive Stunden“, sondern ein Energielimit – ich plane bewusst mit großen Puffern.
- Ich raste vorbeugend: Pausen kommen vor den Warnzeichen. Ein kurzer Wecker erinnert mich daran, rechtzeitig auszusteigen.
- Ich dämpfe Reize: Leiser, dunkler, kürzer – gedämpftes Licht, ruhige Räume. Reize zählen als Belastung, selbst wenn ich „nur sitze“.
- Ich entzerre Aufgaben: Statt „alles am Stück“ mache ich eine Sache nach der anderen – und dazwischen echte Ruhe, nicht „nur schnell noch“.
- Ich nutze Positionen klug: Liegen statt Sitzen, Sitzen statt Stehen – kleine Anpassungen, große Wirkung, vor allem für den Kreislauf.
- Ich plane Ereignisse als Paket: Ein Termin ist nicht nur der Termin. Anfahrt, Warten, Gespräch, Reize und die Erholung danach gehören mit in die Rechnung.
- Ich halte mich an Grenzen – auch an guten Tagen: Ein guter Tag ist kein „Freifahrtschein“, sondern eine Chance, Stabilität zu halten.
Warum dieses Wissen wichtig ist
PEM ist das Herzstück von ME/CFS. Versteht man, dass es verzögert kommt, sich aus Kleinigkeiten summiert und lange nachwirkt, versteht man auch meine Entscheidungen im Alltag: warum ich Puffer brauche, warum ich absage, warum ich mich schütze. Es geht nicht um „sich gehen lassen“, sondern um das kluge Haushalten mit einer sehr knappen Ressource – damit aus einem „ganz guten“ Tag nicht eine „ganz schlechte“ Woche wird