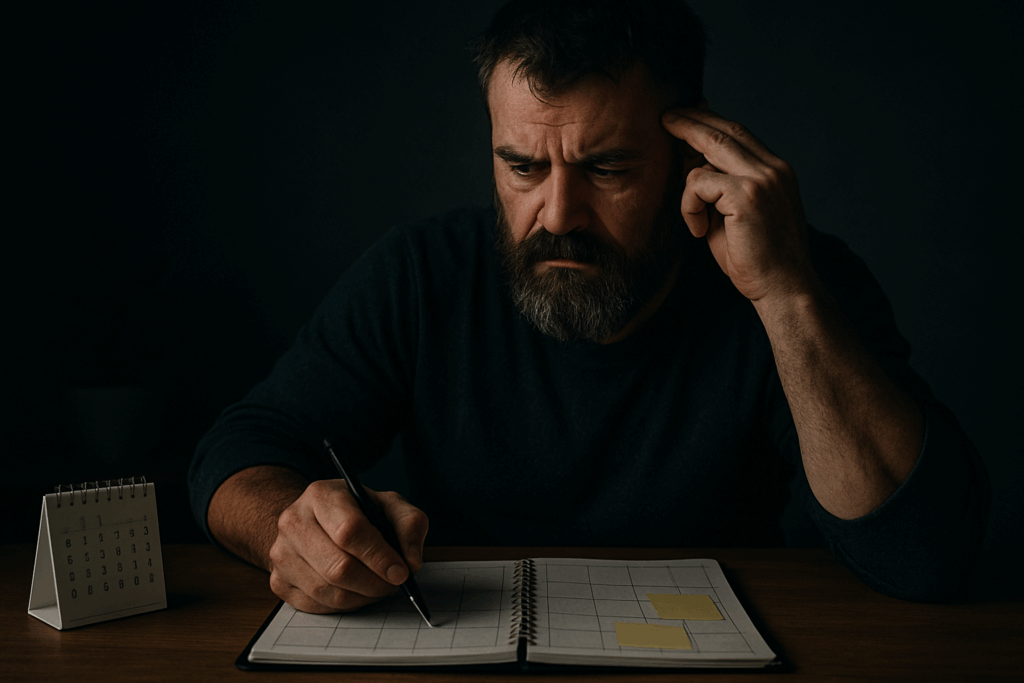Das Stigma haftet an uns wie ein alter Kaugummi unter dem Schuh: Beinahe täglich sehen wir ME-Betroffenen uns damit konfrontiert: unsere Erkrankung wird von Gesundheits- und Rentensystem als psychosomatisch betitelt, und auch unser persönliches Umfeld ist oft genug davon überzeugt, dass unsere Energielosigkeit die Folge mangelnden Antriebs sei.
Sich dagegen zu verteidigen ist anstrengend, und selbst mit einer guten Portion Resilienz kommt man in vielen Situation an der Verteidigung nicht vorbei.
Fakten
ME/CFS ist seit Jahren international ganz eindeutig als schwere, neuroimmunologische Erkrankung klassifiziert. Schon der ICD-Schlüssel G93.3 ordnet die Krankheit neurologisch ein. Und selbst bei der sehr dünnen Studienlage zu ME ist mittlerweile eindeutig belegt, dass organische Faktoren diese Erkrankung verursachen.
Das wird immer wieder – vor allem aus Deutschland – versucht zu torpedieren, und selbst in Fachkreisen weiss wirklich niemand, warum das so ist. Statt sich nun der internationalen Forschungsgemeinschaft anzuschließen und den – zugegeben komplizierten – Weg auf der Suche nach Biomarkern und Behandlungen zu gehen, wird im deutschsprachigen Raum immer noch und immer wieder versucht, die Uhr 15 Jahre zurückzudrehen und ME/CFS als „Hysterie“ oder Anpassungsstörung zu stempeln.
Risiken der Fehleinschätzung
Die weitaus meisten Betroffenen werden in die Psycho-Schublade gesteckt, zumindest vorerst. Damit ist ihnen nicht geholfen, sondern eher geschadet: gängige Methoden zur Behandlung von psychischen Erkrankungen basieren meist auf Aktivierung, sowohl geistig-emotional wie auch körperlich. Und all das ist bei ME/CFS wissenschaftlich belegt schädlich. Fatalerweise ist aber die Fehleinschätzung von ME oftmals so fest verankert, dass beispielsweise ein totaler Zusammenbruch während einer aktivierenden Reha dann als „mangelnde Mitwirkung“ gestempelt wird.
Spürbare Unsicherheit bei Ärzten
Auf dem Weg zur Diagnose durfte ich erleben, zu was die Unsicherheit hinsichtlich der Einordnung von ME führen kann. Mit klassischen Diagnoseverfahren konnte beim Hausarzt nichts festgestellt werden. Es folgte schnell die Einstufung als psychische Erkrankung. Weil aber die klassischen Indikatoren für eine Depression auch nicht zu finden waren, wurde selbst diese Diagnose – obwohl sie gestellt wurde – nicht weiter verfolgt. Man wird also überhaupt nicht behandelt. Und mit jedem weiteren Besuch beim Arzt, mit jedem neuen Symptom, verstärkt sich beim Doc der Eindruck von Hypochondrie oder Simulantentum.
Verharmlosung
In der allgemeinen Wahrnehmung ist eine Depression eine bloße „Befindlichkeitsstörung“. Sie ist etwas, das man bekommt wenn man schwach ist, und man ist da auch selber dran schuld. Mit ein bisschen weniger Stress, einem guten Tee und einem Spaziergang kann man das vermeiden. Und wenn man einmal im Loch hängt, dann kommt man da wieder raus – wenn man das den will und sich nur ganz doll anstrengt.
Diese Denkweise ist grundfalsch. Die Depression ist eine ernsthafte Krankheit mit einer extrem hohen Sterblichkeit. Und sie kann jeden treffen. Sie hat nichts mit Wollen zu tun, ganz vereinfacht gesagt fehlt dem Depressiven nämlich die Fähigkeit zu Wollen. Er braucht professionelle Hilfe, und der Weg raus ist extrem hart. Niemand belächelt den Schlaganfall-Patienten, der gemeinsam mit dem Logopäden mühsam neue Bahnen im Gehirn baut um wieder sprechen zu lernen. Aber die harte Arbeit, die Psychotherapeuten und Patienten gemeinsam leisten um neue Denkmuster zu etablieren, die wird auch heute noch größtenteils belächelt.
Wenn nun ME-Patienten den Stempel einer Depression als Ursache für ihre Erkrankung aufgedrückt bekommen, wird es pervers. Unsere Krankheit lässt sich durch Training nicht heilen, ganz besonders nicht durch körperliche Anstrengung oder bloße Willensanstrengung. Wir können Wollen so viel wir wollen, die Energie ist schlicht nicht da. Aber wie sollen wir das beweisen?
Rechtfertigungszwang
Zuerst stellt sich die Frage, warum wir das ständig beweisen müssen. Die wichtigste Antwort: weil wir sonst keine Hilfe bekommen oder schlimmstenfalls schädliche Behandlungsversuche durchleben müssen.
Wichtig ist aber auch: weil wir sonst ständig Schuldgefühle eingetrichtert bekommen. Gegen die hilft zwar eine ordentliche Portion Resilienz, die wiederum erfordert aber auch einen erheblichen Energieeinsatz. Energie, die für andere Zwecke sicherlich besser eingesetzt werden könnte, denn unser Kontingent ist extrem begrenzt.
Hinzu kommt: das ständige Mantra „du musst das nur wollen“ triggert uns dazu, regelmäßig unsere Grenzen zu überschreiten um an einem einigermaßen normalen Sozialleben teilhaben zu können. Um das Thema gar nicht erst aufkommen zu lassen mobilisieren wir nach Außen alle Reserven. Dann wirken wir „normal“ und angepasst und entgehen dem ständigen Erklären. Um dann – für andere nicht sichbar – wenige Stunden später dem totalen Kollaps zu erliegen, der nunmal das wichtigste Merkmal für ME ist.
Beweislast
Spätestens dann, wenn es um Sozialleistungen geht, müssen wir dann auch noch beweisen, dass wir wirklich krank und nicht „nur“ depressiv sind. Nur dann bekommen wir Hilfsmittel wie Rollstühle oder Stützstrümpfe, oder eben im schlimmsten Fall auch ein Pflegebett nebst Personal. Und hier wird es schwierig. Gutachter und Ärzte hangeln sich an veralteten und inhaltlich falschen Leitlinien entlang und klopfen zuerst die psychiatrischen Faktoren ab. Und schaut man sich dann die Fragebögen an, wird es abenteuerlich:
Das „Beck’sche Depressions-Inventar“ ist ein ganz klassischer Test auf schwere depressive Störungen und für solche ist er auch gut geeignet. Ein Patient mit einer schweren körperlichen Erkrankung wird hier wohl kaum besonders positive Antworten ankreuzen können und zeigt damit zwangsläufig alle Anzeichen einer schweren Depression.
In der Praxis aber passiert nun folgendes: ein ME-Patient mit bereits diagnostizierter organischer Erkrankung wird einem Gutachter vorgestellt, der aufgrund der falschen Einstufung durch beispielsweise die Rentenversicherung ein psychiatrisches Gutachten erstellen soll. Ganz unzweifelhaft wird mit einem Fragenkatalog wie dem BDI und dem Auftrag, eine psychiatrische Erkrankung zu diagnostizieren, auch ganz genau das herauskommen: der Patient ist hochgradig depressiv. Und leider zeigt die überwiegende Zahl der Fallberichte, dass dort dann auch erst mal Schluss ist.
Statt eines Rollstuhles bekommen Betroffene dann die Empfehlung zur Psychotherapie oder werden in eine Reha geschickt, die ihnen mehr schadet als nutzt. Ganz blöd wird es, wenn die körperlichen Beschwerden vollständig ignoriert werden (das bildet sich der Depressive ja auch nur ein) und aufgrund der psychiatrischen Untersuchung Arbeitsfähigkeit attestiert wird, obwohl – und auch solche Fälle gibt es zu genüge – der Betroffene bestenfalls für 2 Stunden täglich das Bett verlassen kann.
Vielleicht „auch“ depressiv?
Es besteht bei schweren Erkrankungen oft eine Komorbidität mit Depressionen. Ehrlicherweise wäre es auch naiv davon auszugehen, dass eine Krankheit wie ME, die in ausnahmslos allen Lebensbereichen schwerste Einschränkungen mit sich bringt, spurlos an der Psyche vorbeigehen könnte. Und so brauchen auch wir Betroffenen oft therapeutische Unterstützung.
Trotzdem ist die Depression nicht die Ursache unserer Probleme, sondern die Folge der schweren Erkrankung. Leider wird das nur all zu oft verdreht. Und wenn schon in Leitlinien zur Begutachtung die ME selbst entgegen aller wissenschaftlicher Erkenntnisse als psychosomatisch eingestuft ist, dann wird das Ganze praktisch zwangsläufig verdreht. Mit allen Risiken für Betroffene.
Ungesunde Resonanz
Und aus all dem spannt sich dann wieder ein Bogen zurück: die „behördlich“ und systematisch falsche Einstufung in Richtung Psychiatrie führt ganz am Ende zu großen Sorgen hinsichtlich wirtschaftlicher Existenz und gesundheitlicher Absicherung. Diese Sorgen schwingen bei uns Betroffenen immer mit und machen den Wunsch umso stärker, die Sache klarzustellen.
Da wären wir dann wieder beim Rechtfertigungs-Zwang: jedes Infragestellen der Natur unserer Erkrankung führt zu großen existentiellen Sorgen, und die sind in Fakten begründet und nicht nur in einem vagen Gefühl. Uns so wird jedes „das wird schon wieder, wenn Du nur willst“ zu einem ganz erheblichen Schlag in die Magengrube. Als Schutz davor bleibt entweder das ständige Richtigstellen in der Hoffnung, irgendwie für Klarheit zu sorgen, oder die totale Isolation und Vermeidung. Das aber sorgt sehr schnell dafür, dass die eigene Depressivität befeuert wird. Schlimmstenfalls – und es gibt leider genug Fälle dazu – bis zu totaler Verzweiflung und Suizid.
Wir müssen da raus. Jetzt!
All das sind Gründe, warum ich mich so sehr gegen die Psychologisierung wehre, obwohl ich definitiv schon aufgrund meiner privaten und beruflichen Vergangenenheit psychische Erkrankungen nicht abwerten möchte. Ich möchte Klarheit darüber, dass Depressionen ganz natürlicherweise bei schweren Erkrankungen dazugehören und genauso behandelt werden müssen wie die Krankheitsursache an sich, dass aber eben die zugrundeliegende Erkrankung der Punkt sein muss, der primär betrachtet und behandelt wird.
Es braucht besser gestern als heute Änderungen im System: Sozialversicherer müssen jetzt endlich ihre Leistungs- und Beurteilungskataloge einem wissenschaftlichen Konsens anpassen, der schon über Jahre international gültig ist. Die katastrophale Fehleinschätzung als psychosmatische Störung bei Krankheiten wie ME/CFS oder Fibromylagie muss korrigiert werden, um Betroffenen Zugang zu Hilfen zu ermöglichen und die bürokratisch verursachte Zustandsverschlechterung zu unterbrechen.
Und es kann gar nicht genug Auflärung für die Allgemeinheit geben. Zu ME/CFS, aber eben auch zu psychischen Krankheiten. Das völlig verzerrte Bild, das viele Menschen da draußen vor sich haben, macht allen Betroffenen das Leben schwer und führt nicht zuletzt auch zu gesellschaftlichen Spannungen: Menschen mit nicht sichtbaren Krankheiten werden schnell als Schmarotzer oder „Verpisser“ in Schubladen gepackt.